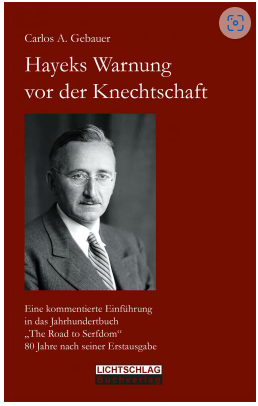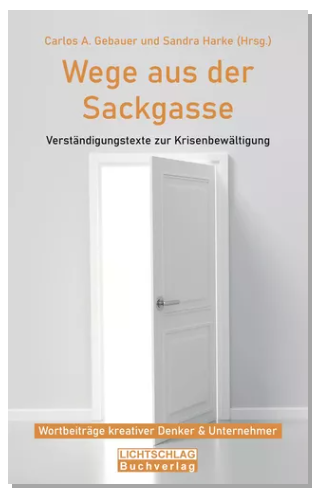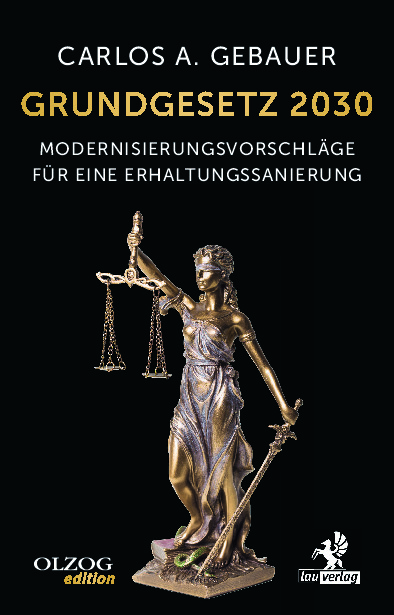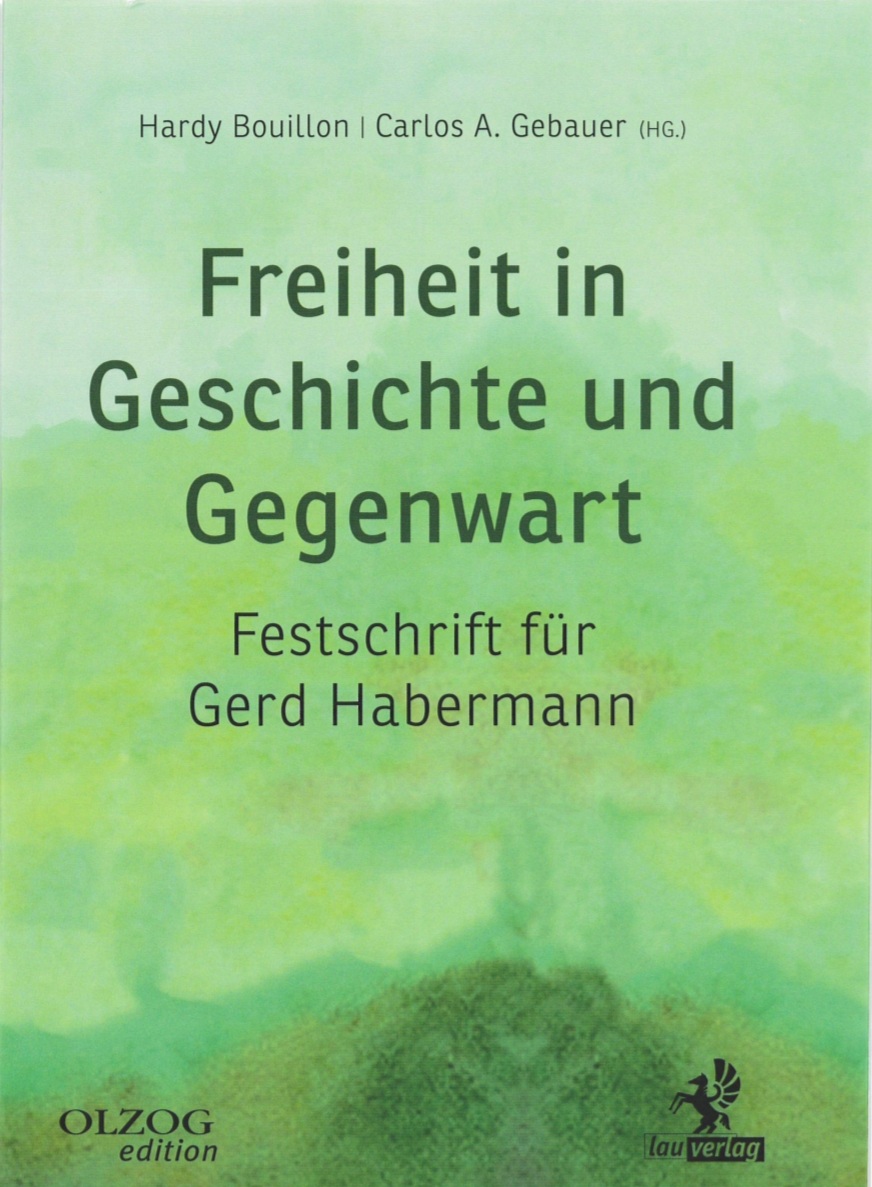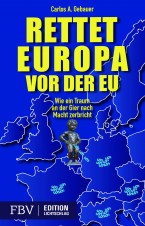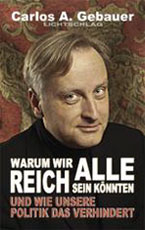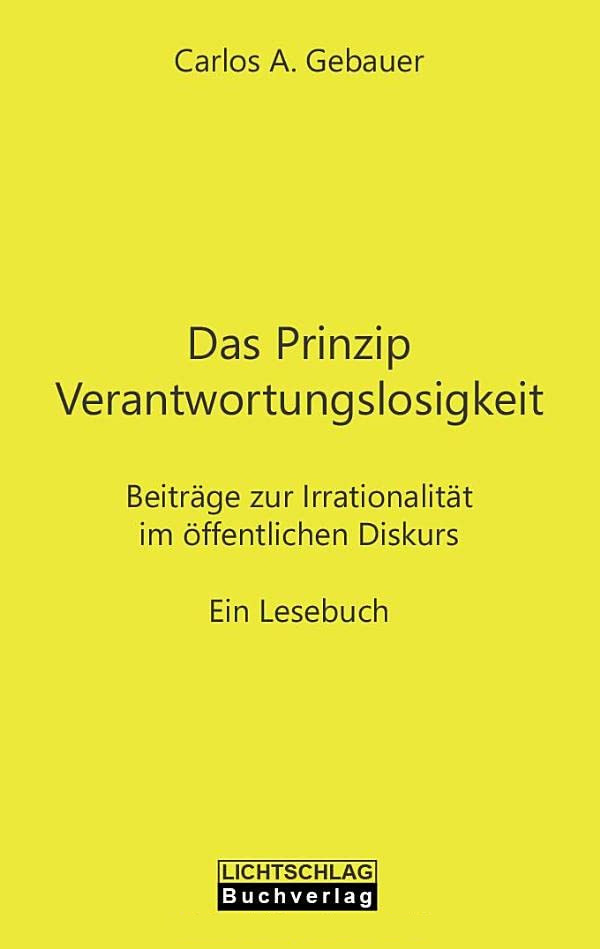Carlos A. Gebauer
Seinerzeit war es entsetzlich. Es hatte viel Unsicherheit geherrscht und niemand wußte wirklich, wie er sich verhalten sollte. Wer damals nicht dabei gewesen ist, kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen. Am 28. Juni 2004 aber war es dann – endlich – vorbei: Das Bundesgesetzblatt wurde ausgegeben und sie lag vor, die „Verordnung über die Berufsausbildung zur Sonnenschutzmechatronikerin“.
Julia F. kann nun – staatlich anerkannt und in ordentlich reformierter Rechtschreibung beschrieben – „Rollläden“ qualifiziert beruflich herstellen, sobald sie den Ausbildungsberuf verordnungskonform erlernt hat. Was aber muß Julia F. lernen, um die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu beherrschen?
An erster Stelle nennt das Gesetz die Kenntnis von „Arbeits- und Tarifrecht“. Ein befreundeter Zyniker spottete, danach bleibe also die Terrasse eines Kunden so lange ein sonniges Plätzchen, wie der Sonnenschutzmechatroniker sein Tarifrecht noch nicht kenne. Doch auch der schon zum Arbeitsrechtsexperten erzogene Auszubildende greift dann noch lange nicht zu Stoff und Schraube. Sicherheit bei der Arbeit, Umweltschutz und der Umgang mit Kommunikationstechniken müssen zuvor mit dem Lehrherren besprochen werden. So will es das Gesetz. Erst dann geht es – an zehnter Stelle des Ausbildungsplanes – an das Herstellen von Rollpanzern, Steuerungskomponenten und Fensterkombinationen.
So schleppt sich die Ausbildung des Sonnenschützers und Rollladenmechatronikers über die sechsunddreißigmonatige Zeit und durch das dokumentierende Berichtsheft, bis eines Tages – an siebzehnter Stelle des Lehrplanes – auch für Julia F. eine weitere Dimension des künftigen Broterwerbes aufscheint: Die Faszination, Arbeiten kundenorientiert durchzuführen, Kundenwünsche mit dem betrieblichen Leistungsspektrum zu vergleichen und fertiggestellte Arbeiten an den Kunden zu übergeben.
Wer um das Wohlergehen von Julia F. besorgt ist, fragt sich allerdings, warum die Ausbildungsverordnung nicht nochmals gesondert hinweist auf die Lastenhandhabungsverordnung. Eine schwere Unterlassung des Gesetzgebers. Denn wer könnte Zweifeln, daß gerade ein unhandliches Sonnenschutzrollo aufgrund seiner ungünstigen ergonomischen Bedingungen für die angehende Sonnenschutzmechatronikerin eine erhebliche Gefährdung für ihre Lendenwirbelsäule birgt? Gerade dann, wenn bei dem Kunden der in vertikaler Richtung zur Verfügung stehende Platz eingeschränkt ist und die zu erwartende Luftgeschwindigkeit Gesundheitsgefahren birgt, ist der Anwendungsbereich dieser Arbeitsschutzverordnung bekanntlich weit eröffnet.
Der Lehrherr von Julia F., Manfred L., sieht die bevorstehende Ausbildungszeit gelassen. Seine feste Absicht ist, sich nicht an die Verordnung zu halten und Julia F. schlicht erst einmal das beizubringen, was sie für das Leben als Sonnenschutzmechatronikerin am wesentlichsten braucht: Wissen, was der Kunde will und wissen, ob man es ihm bauen kann. Papier, sagt Manfred L., ist geduldig, Kunden sind es nicht. Zwar träumen sie alle von einem Platz an der Sonne. Aber wenn die Wolken weichen, wollen sie schnell ein schattiges Plätzchen. Das jedenfalls hat ihn die Praxis gelehrt. Allen Verordnungen zum Trotz. Vielleicht, sagt Manfred L., wird auch der Gesetzgeber eines Tages lernen, was im Leben noch wichtiger ist, als Tarifrecht oder die Beziehungen zu Wirtschaftsorganisationen und Gewerkschaften. Es ist: Sein Handwerk beherrschen und den Kunden verstehen. Das will er Julia F. zeigen. Denn das ist sein Wunder von Lern.